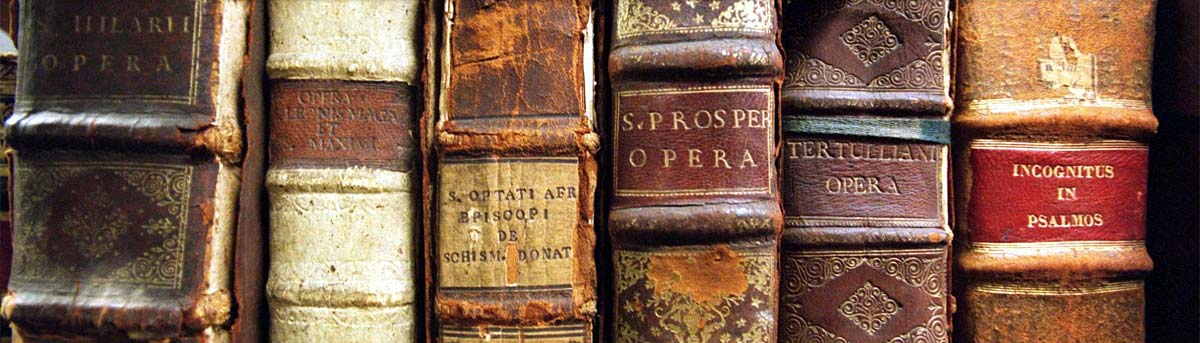Das Dorf Assenheim ist als fränkische Gründung im Jahr 777 im
Lorscher Kodex erwähnt. Es gehörte zunächst dem
Benediktinerkloster Weißenburg und stand dann jahrhundertelang
unter der Lehensherrschaft der Grafen von Leiningen. Entlang der
Dorfstraße entwickelte sich Assenheim zu einem typischen
Straßendorf mit Kirche und Rathaus im Zentrum. Östliches
Bebauungsende war der bereits um 1392 erwähnte Limburger
Klosterhof.
Seit der Angliederung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich
im Jahre 1797 gehörte Assenheim zum Kanton Mutterstadt im
Arrondisement Speyer des Departement Tonere (Donnersberg) und
später zum Bezirksamt Ludwigshafen im „Bayerischen Rheinkreis“.
Früher gab es wegen mangelnder chemischer Mittel gegen Schädlinge
viel mehr Mißernten und Krankheiten in den Weinbergen als heute.
Eine solche Mißernte traf im Jahre 1529 auch die Gemeinde
Assenheim. Die Fässer in den Kellern blieben leer, im Wirtshaus
gab es keinen Schluck des edlen Rebensaftes mehr und
Niedergeschlagenheit lastete auf den Gemütern der Assenheimer, da
die Arbeit eines ganzen Jahres jetzt nun ohne Lohn blieb.
Es war Weihnachten geworden und die Assenheimer stapften durch
den tiefen Schnee zur Christmette. Zuvor aber hatten sie nicht
vergessen, im Garten die Obstbäume zu wecken, denn diese durften
die Christmette nicht verschlafen, sonst trugen sie im nächsten
Jahr keine Früchte. So jedenfalls wollte es der Brauch seit
altersher.
Nach der Christmette, als die Assenheimer Wirtsfamilie gerade zu
Bett gehen wollte, klopfte es am großen Hoftor. Eine schlanke,
großgewachsene Frau, das Gesicht mit einem Schleier verhüllt, bat
darum, sich aufwärmen zu dürfen. Sie nahm am Tisch Platz und ließ
sich den ihr angebotenen Hirsebrei schmecken. Sie komme vom
Gebirge, meinte sie, und ihr Ziel sei nicht mehr weit.
Die freundlichen und hilfsbereiten Wirtsleute wollten ihr einen
Umhang und eine Laterne holen, aber als sie in die Stube
zurückkehrten, war die Frau gegangen, ohne im frischen Schnee
eine Spur hinterlassen zu haben. Auf dem Tisch lagen
wunderschöne, rote Blüten, die herrlich nach Wein dufteten. Der
Wirt nahm eine solche Blüte, rieb an deren Unterfläche, und der
Weinduft verbreitete sich schnell in der ganzen Wirtsstube. „Das
sind Weinrosen“, sagte der Wirt feierlich, „wenn sie in der
Christnacht blühen, gibt es im nächsten Jahr eine gute Ernte.“
So geschah es dann auch. Die Fässer des Wirtes reichten kaum aus,
um den Segen des folgenden Jahres zu fassen. Man erinnerte sich
an die Frau im Schleier, aber niemand wußte etwas von ihr und sie
wurde auch nie wieder in Assenheim gesehen.
Aus: Die Rheinpfalz, Rudolf Köstlmaier, 30.1.1996