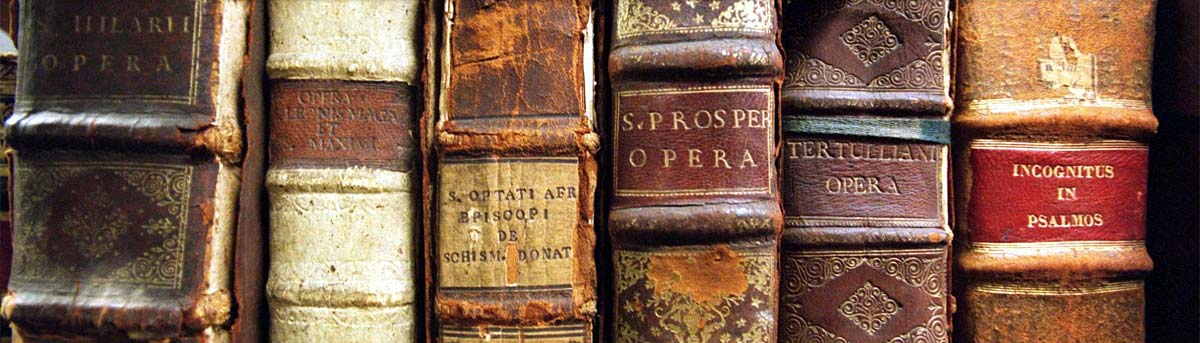Einem echten Kurpfälzer ist es zu verdanken, daß das weltweit
erste psychologische Lehrbuch veröffentlicht wurde. Es war Dr.
Wilhelm Wundt, der an der damals südlichen Peripherie Mannheims
in Neckarau geboren wurde und seine akademische Karriere in
Heidelberg begann, aber an der Universität Leipzig sein „Institut
für experimentelle Psychologie“ gründete. Das Leipziger Institut
entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem Mekka für führende
Köpfe dieser neuen Disziplin.
Indes ist über Wilhelm Wundt, der aus der Verbindung von
Physiologie und Philosophie die neue Disziplin der Psychologie
schuf, im Gegensatz etwa zu Sigmund Freud, dem Begründer der
Psychoanalyse, nur wenig bekannt in der Öffentlichkeit.
Zwei große Strömungen � die Naturwissenschaften und die
Philosophie � hat Wundt zusammengeführt und daraus die
Experimentalpsychologie entwickelt. Die drei Wundtschen Kriterien
für das Experiment, Willkürlichkeit, Wiederholbarkeit und
Variierbarkeit, werden noch heute in jedem psychologischen
Lehrbuch zitiert.
Fast 20 Jahre lang war Wilhelm Wundt der Heidelberger Universität
und der Stadtgeschichte verbunden. 1856 hatte er an der Ruperto
Carola zum Dr. med. promoviert und wurde bereits ein Jahr später
als Privatdozent für Physiologie habilitiert. Nach einer
fünfjährigen Assistenzzeit bei dem berühmten Naturforscher
Hermann von Helmholtz wurde er 1864 Professor für Anthropologie
und medizinische Psychologie in Heidelberg und nach einem kurzen
Ausflug in die Politik als Abgeordneter im Badischen Landtag,
1874 Professor für Induktive Philosophie in Zürich. Ein Jahr
später erhielt er dann ein Ruf der Leipziger Universität. Dort
setzte sich die Wandlung vom Physiologen zum Psychologen Wundt
stürmisch fort.
Was weiß man aber von dem Menschen Wilhelm Wundt in der Kurpfalz?
Während des Sommersemesters 1857, kurz nach seiner Habilitierung,
erlitt Wundt eine schwere Lungenerkrankung, unterbrach seine
Lehrtätigkeit und bewarb sich 1858 als Assistent von Hermann von
Helmholtz. Dieser sagte zu. Bis 1863, also in fünf Jahren
Assistentenzeit, hatte Wundt trotz vieler Konditionen, die
Helmholtz ihm aufgebürdet hatte, 50 Artikel und mehr als 2.000
Buchseiten auf seinen Spezialgebieten der physiologischen
Psychologie und der Völkerpsychologie publiziert.
Unter anderem hatte ihm sein Chef für 300 Gulden Jahressalär (das
Existenzminimum für einen Privatdozenten) neben zwei bis drei
Stunden Unterricht in der Woche, auch die Vivisektionen und die
Vorbereitungen aufwendiger Experimente sowie die Vorbereitung
sämtlicher Vorlesungsversuche und den Unterricht in
mikroskopischer Anatomie auferlegt. Das Mikroskopieren
verursachte schließlich auch einen sogenannten Astigmatismus,
eine krankhafte Veränderung der Hornhautkrümmung, der in Leipzig
dann zu seiner vollständigen Erblindung führte.
Zwar hätte Helmholtz‘ Untersuchungen über die Akustik und Wundts
Arbeiten über die physiologische Psychologie eine Zusammenarbeit
nahegelegt, doch tauschten sich die beiden Wissenschaftler
überhaupt nicht aus. Der Grund hierfür ist in der
Sozialgeschichte der Universität und Stadt zu suchen. Noch 1863
empfahl Helmholtz in einem Gutachten seinen Assistenten für die
Stelle eines außerordentlichen Professors und hob dabei seine
hervorragenden Kenntnisse hervor. Seine Befähigung, eine
wissenschaftliche Verbindung der Physiologie der Sinnesorgane und
der Psychologie zu schaffen, bezeichnete er als „das gänzlich
Neue“.
Um so erstaunlicher ist, daß er 1868 in einem Brief moniert,
Wundt würde „in der Politik herumdümpeln und in Arbeiterkreisen
verkehren“, und dies nur, um zu Geld zu kommen. Die politische
Situation in Heidelberg erhellt den Hintergrund des Verdikts.
Helmholtz fand es merkwürdig, daß ein junger Wissenschaftler,
statt an seiner Karriere zu basteln, in die Politik gehen wollte.
In Baden existierte damals die Tradition der liberalen
Intellektuellen, die aktiv in Kommunal� und Staatspolitik
eingriffen. Diese Tradition war Helmholtz suspekt. Er selbst war
nicht zuletzt durch die Heirat mit der Tochter des Hauses von
Mohl rasch, möglicherweise wider Willen, in die „verknöcherte
Ordinarienwelt“ integriert worden. Die jungen Privatdozenten und
Professoren, die sich in einem Kreis um Henriette Feuerbach
zusammenfanden, erkannten hingegen die sozialen Probleme der
Bevölkerung und sahen sich bemüßigt zu handeln.
In seinen Vorlesungen über die Menschen� und Tierseele, die
Wilhelm Wundt 1864 verfaßte, legte er seine ethnischen Grundlagen
des politischen Engagements fest: Der vierte Stand, also die
Arbeiter und Handwerker, sollte durch Bildung sowie Hilfe zur
Selbsthilfe emanzipiert werden. 1863 hatten deshalb verschiedene
junge Dozenten und Professoren in Heidelberg den
Arbeiterbildungsverein gegründet. Den Arbeitern und Handwerkern
wurde Fortbildung in Rechnen, Schreiben und Englisch angeboten.
Dazu kam ein Freizeitprogramm mit Laientheater und Chor sowie
ziemlich ermüdenden Vorträgen aus Dozentenkreisen. Wundt führte
den Vorsitz und kam rasch in Kontakt mit anderen Zirkeln der
Arbeiterbewegung.
1866 wurde er dann von einem Wahlmännergremium in die Zweite
badische Kammer nach Karlsruhe entsandt. Bereits seit 1863 hatte
er an entscheidenden Reformgesetzen mitgearbeitet. Er setzte sich
unter anderem für neue Schulgesetze, die Gewerbefreiheit und die
Gleichstellung der Juden ein. Ein Gesetz paukte der
Nationalliberale Wundt mit seinen Parteifreunden gar selbst
durch: Die Gleichstellung der akademischen Bürger mit den
„Normalsterblichen“ vor dem Gesetz � und nebenbei auch die
Bestrafung jeden Duellhandels.
Der Krieg zwischen Preußen und Österreich im Jahre 1866, in den
auch Baden hineingezogen wurde, veränderte die politische
Stellung der Heidelberger Intellektuellen. Rasch wandelten sich
die Heidelberger Professoren von Verteidigern des alten Habsburg
zu glühenden Verehrern Bismarcks. Wundt hatte jedoch seine
Stellungnahme in der renommierten „Allgemeinen Augsburger
Zeitung“ dezidiert gegen den „undemokratischen Bismarck“
formuliert � und bezog bald politische Prügel, bis er schließlich
wegen Differenzen mit der Regierung in Karlsruhe sein Mandat
niederlegte.
Das wissenschaftliche Geschäft Wundt gedieh trotzdem. Von 1858
bis 1862 waren sechs Aufsätze über die Theorie der
Sinnewahrnehmung erschienen, die 1862 als Bücher vorlagen. 1863
folgten die zwei Bände über die Menschen� und Tierseele. Das
Lehrbuch der Physiologie des Menschen kam in erster Auflage 1865
heraus und das damals weit verbreitete Handbuch der medizinischen
Physik 1867. Helmholtz hat von all diesen Tätigkeiten wenig
erfahren. Wundt lehrte weiterhin die Studenten, die Mikroskope zu
benutzen und bereitete die Experimente vor. 1865 kündigte er dann
seinen Vertrag mit Helmholtz.
Im deutsch�französischen Krieg 1870 und 1871 arbeiteten die
beiden dann wieder zusammen. Es wurden sogenannte
Hilfslazarettzüge zusammengestellt, die Verwundete von den
Frontlinien nach Heidelberg brachten. Helmholtz, Wundt und andere
fuhren nach Straßburg und brachten französische und deutsche
Soldaten mit, die in einer Reihe von Krankenstationen, darunter
auch der Marstall und das Freimaurerhaus, versorgt wurden. Beide
veranstalteten wiederholt Kolloquien über die effiziente
Behandlung von Kriegsverletzung, und für beide war es die letzte
Berührung mit der medizinischen Praxis.
Als Wundt am 3. August 1870 am Bahnhof auf einen Lazarettzug
wartete, traf die Nachricht der Gefangennahme Napoleons III. in
Heidelberg ein. Wundt zog daraufhin mit einem Trommler durch die
finsteren Gassen der Altstadt und verkündete den Sieg. Das
brachte ihm eine Rüge wegen Ruhestörung ein. Nur ein Jahr später
feierten indessen die Bürger Heidelbergs den Sedantag mit nicht
endenwollendem Patriotismus bis in die späte Nacht.
Wundt wurde 1874 nach Zürich berufen und etablierte sich dann in
Leipzig. 1902 bezog er dann seinen Altersruhesitz in der Plöck.
Dort im Haus Nr. 50, das er auch in vielen Sommermonaten
bewohnte, lebte er dann bis zu seinem Tod. Das Haus wurde
gemeinsam mit dem Nachbarhaus später abgerissen. Nur noch eine
Inschrift an der Betonfassade, die überdies meist von
Müllcontainern umstellt ist, zeugt von der Zeit, die der
Begründer der experimentellen Psychologie in Heidelberg verbracht
hat.
Aus: RNZ, 27.10.1995, Gustav-�Adolf Ungerer
 Heidelberg als legendärer Sehnsuchtsort der Dichter
Heidelberg als legendärer Sehnsuchtsort der Dichter