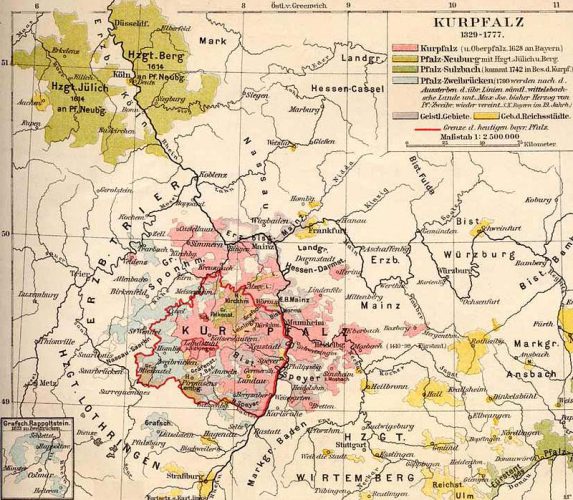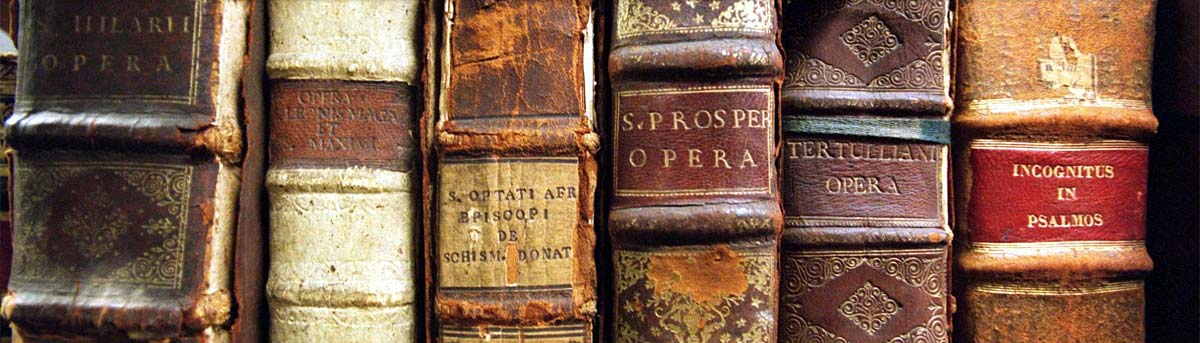Die Ritter, die auf ihren Burgen zwischen Pfälzerwald und
Odenwald lebten, waren nicht zu beneiden. Zwar ging es ihnen
wesentlich besser als den Bauern, von deren Abgaben sie lebten,
doch im Vergleich zu den reichen Handelsherren entbehrten die
Adeligen vieler Bequemlichkeiten. Sie, die „Pfeffersäcke“,
wohnten in den Städten, in der Behaglichkeit ihrer Bürgerhäuser;
sie, die Herren Ritter, hausten auf ihren Burgen weitab von jeder
größeren Ansiedlung.
Ein weitgereister Ritter aus der Pfalz verkündete in einer noch
erhaltenen Handschrift: „An Unterhaltung fehlt es nicht. Viel
Eselschreien, Pfauenkreischen � davon hab ich die Nase voll! Mir
tost der Bach mit Hurlahei den Kopf entzwei. Er ist schon völlig
wund!“ Keine Rede von deftigen Festgelagen, wie sie heute bei den
„Rittermahlen“ in alten Burgen fröhlich gefeiert werden.
Minnegesang, edle Frauen? Fehlanzeige! „Kein feiner Umgang mehr,
stattdes: Nur Kälber, Geißen, Böcke, Rinder und Bauerndeppen.
Häßlich schwarz, im Winter ganz verrotzt. Macht froh wie
Pansch�Wein, Wanzenbiß …“
Die Auswirkungen auf das Familienleben waren geradezu verheerend:
„In der Beklemmung hau ich oft die Kinder in die Ecken. Da kommt
die Mutter angewetzt, beginnt sogleich zu zetern. Gäb sie mir mit
der Faust, ich müßt auch das erdulden“.
Wo bleibt da die Ritterlichkeit, wo bleibt die Romantik? Ein
treffliches Stichwort: Es waren die Romantiker des 19.
Jahrhunderts, die das Bild und das Leben in einer Ritterburg
schufen und idealisierten. Sie, die die mittelalterliche
Literatur, die Heldenepen und Minnelieder dem Staub der Archive
entrissen hatten, nahmen die darin beschriebenen
Idealvorstellungen des Rittertums für bare Münze. In ihrer
Phantasie wurde so selbst aus dem heruntergekommensten
Strauchritter ein stolzgesinnter Kriegsmann von eherner Kraft
oder wie sonst die überspannten Formulierungen der damaligen Zeit
lauteten.
Ein Gespräch mit Ulrich von Hutten, dem Humanisten, der auf der
nordhessischen Steckelsburg aufgewachsen war, hätte die
Heidelberger Romantiker von damals (und auch die von heute) rasch
ihrer Illusionen beraubt. 1518 schrieb der Ritter an seinen
Freund, den Nürnberger Patrizier Willibald Pirckheimer: „Die Burg
ist nicht gebaut, um schön sondern um fest zu sein, von Wall und
Graben umgeben, innen eng, da von Stallungen für Vieh und Herden
verbaut. Daneben liegen die dunklen Kammern, angefüllt mit
Geschütz, Pech und Schwefel und dem üblichen Zubehör der Waffen
und Kriegswerkzeuge. Überall stinkt es nach Pulver. Dazu kommen
die Hunde mit ihrem Dreck. Eine liebliche Angelegenheit, wie sich
denken läßt, und ein feiner Duft! Reiter kommen und gehen, unter
ihnen Räuber, Diebe, Banditen; denn für alle steht unser Haus
offen. Man hört das Blöken der Schafe, das Brüllen der Rinder,
das Hundegebell, das Rufen der Arbeiter auf dem Felde, das
Knarren und Rattern von Fuhrwerken, ja wahrhaftig auch das Heulen
der Wölfe, da der Wald so nahe ist. Ihr Bürger lebt in den
Städten nicht nur angenehmer, sondern auch bequemer.
So ging es also auf den Burgen des niederen Adels zu. Spuren von
Romantik fanden sich allenfalls auf den schon ehe schloßähnlichen
Anlagen des Hochadels, der Fürsten, der Könige, der Kaiser. Hier,
bei Hof, gab es das „höfische“ Leben mit all seiner Raffinesse,
nicht aber in den Ritterburgen weitab von den Zentren der Macht.
Im Winter allerdings dürfte es auch dem Kaiser oft ungemütlich
geworden sein, obwohl die meist in der Ebene angelegten Pfalzen
den Unbilden des Klimas eher zu trotzen vermochten als die
windumheulten Felsennester. „Möhte ich verslafen des winters
zit!“, wünschte sich Walther von der Vogelweide, und dazu hatte
er allen Grund. Denn heizen im heutigen Sinn ließ sich eine Burg
nämlich nicht. Die dicken Mauern strahlten Kälte ab, gegen die
die Wärme aus den offenen Kaminen vergeblich ankämpfte. Heizbar
waren zudem nur wenige Räume, so das Frauenhaus, die Kemenate,
deren Namen von „Kamin“ abgeleitet ist. Im Winter pfiff ein
eisiger Wind durch die Burg, denn Fensterglas hielt in den
Anlagen des niederen Adels erst gegen Ende des Mittelalters
Einzug. Zuvor verschloß man die Fenster mit Holzläden und
verstopfte die Ritzen mit Stroh. Gicht und Rheuma dürften die
Recken häufiger gelähmt haben als in der Schlacht empfangene
Wunden.
Vor dem Aufkommen der Kachelöfen muß die Luft in den Räumen nach
unseren Maßstäben äußerst gesundheitsgefährdend gewesen sein. Die
Kaminfeuer verräucherten die Zimmer, und der Qualm von Kerzen,
Öllampen oder Kienspänen, die der Beleuchtung dienten, trug
ebenfalls zu der „dicken Luft“ bei. Die offenen Feuer� und
Lichtquellen brachten auch ganz greifbare Gefahren mit sich, denn
das Innere der Wohngebäude bestand größtenteils aus Holz.
Der Winter bedeutete zumindest für die Bewohner abgelegener
Burgen eine Zeit der Isolation. Nach starkem Schneefall waren
viele Anlagen von der Außenwelt abgeschnitten. Neben
gelegentlichen Besuchen blieb außer Brettspielen wie Dame und
Schach die Jagd als Abwechslung. Sie bot auch Gelegenheit, die im
Winter recht eintönige Speisekarte mit Frischfleisch
anzureichern.
In der warmen Jahreszeit kamen die Feinschmecker eher auf ihre
Kosten: Fleisch, Geflügel, Wild, Fisch, Eier, Frischgemüse, Obst
und Weißbrot fanden selbst die kleinen Adeligen auf ihrer Tafel
vor, während sich die Bauern in der Regel mit Sauerkraut,
Hülsenfrüchten, dunklem Brot und Brei begnügen mußten.
„Höfisch“ ging es bei den Mahlzeiten nicht gerade zu. Gabeln waren
noch weitgehend unbekannt. Löffel, Messer und Finger galt es als
Hilfsmittel zur Nahrungsaufnahme zu benutzen, wobei sich häufig
mehrere Personen aus einer Schüssel bedienten. Regelrechte
Freßorgien kamen nicht selten vor, während Saufereien wohl eher
die Regel waren. Über den 1495 in Worms abgehaltenen Reichstag
vermeldet der Chronist denn auch, daß sich „die Edelleut mit
Saufen auf diesem Reichstag ziemlich säuisch gehalten“. Dies
zeigt, wie es zumindest im späten Mittelalter um die ritterlichen
Tugenden der „maze“ (Maßhalten) und der „zucht“ (Selbstdisziplin)
bestellt war.
Ob die Versuche, den üblen Manieren mittels „Tischzuchten“
aufzuhelfen, viel Erfolg hatten, muß bezweifelt werden. Sie
werfen aber ein Licht auf die damals üblichen Sitten in den
pfälzischen Landen links und rechts des Rheines: „Derjenige ist
ein ehrloser Sack, der sich über die Schüssel beugt und mit dem
Mund ebenso laut schmatzt wie ein Schwein � der soll beim Vieh
essen“. Deutliche Worte! Auch das Schneuzen ins Tischtuch oder in
die Hand galt als unfein. Andere Regelwerke verboten das Spucken
über die Tafel und legten den Blaublütigen nahe, Essensreste
nicht über den Tischnachbarn hinweg, sondern rücklings den Hunden
zuzuwerfen.
Kein Wunder bei dem herumliegenden Unrat, daß sich die
Burgbewohner mehr mit Ungeziefer als mit Belagerern
herumzuschlagen hatten. Toiletten im heutigen Sinne gab es noch
nicht und die Ecken, die dafür genutzt werden, spotteten jeder
Beschreibung. Aus den Aborterkern plumpste das „Geschäft“ direkt
in den Graben oder an den Fuß der Mauer. Im Sommer dürfte die
Lage einer Burg schon auf größere Entfernungen zu „erschnüffeln“
gewesen sein. Aborttürme gehörten eher zu den Raritäten.
Doppelsitzige Aborte dagegen finden sich häufiger � eine
zweifelsohne kommunikationsfördernde Einrichtung.
Intimsphäre in unserem heutigen Sinne gab es sowieso nicht. Dafür
waren die Raumverhältnisse auf den Burgen viel zu beengt. In der
Regel schlief die Familie des Herrn in einem gemeinsamen Bett,
die Knechte verbrachten die Nächte auf dem Boden des Saals.
Prüderie war den Menschen des Mittelalters ohnehin fremd.
Das Mobiliar war nach heutigen Maßstäben gemessen mehr als
dürftig. Zum Sitzen dienten einfache Bänke oder Hocker, schön
geschnitzte Stühle blieben hohen Herrschaften vorbehalten. Vor
den Mahlzeiten trugen die Diener Klapptische in den Saal, die
nach dem Essen wieder „aufgehoben“ und entfernt wurden. Primitive
Bettgestelle, Truhen und Wandbehänge vervollständigten die
spartanische Einrichtung.
Das Leben auf den ach so romantischen Burgen hatte also wenig
Erhebendes, doch immerhin boten sie ihren Bewohnern Sicherheit.
Das änderte sich, als im 15. Jahrhundert Durchschlagskraft und
Zielgenauigkeit der Geschütze enorme Fortschritte machten. Die
Burgen verloren ihren strategischen Wert, aus den fast
uneinnehmbaren Festen wurden kaum zu verfehlende Zielscheiben.
Ritter, die es sich leisten konnten, zogen die Konsequenzen:
Einige bauten ihre Burgen zu wohnlicheren Schlössern um, andere
kehrten ihnen den Rücken, lebten in der Ebene oder gleich in der
Stadt. Die Burgen verfielen, wurden zerstört und als billige
Steinbrüche benutzt.
Nach: MM, 11.7.1989, Klaus Backes