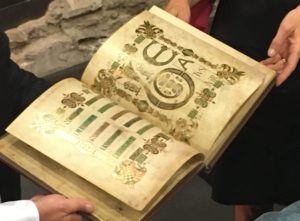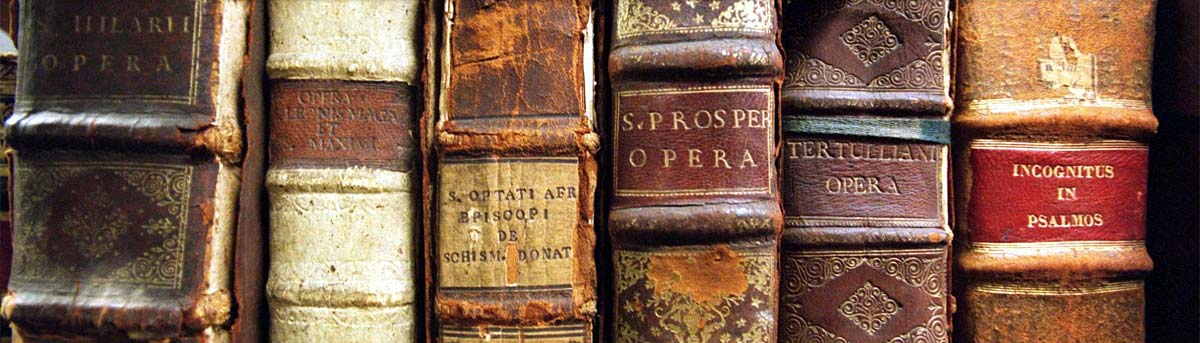Frömmigkeit in den vor allem ländlich geprägten Teilen des
östlichen Odenwaldes kam nach außen hin durch die zahlreichen
religiösen Stätten zum Ausdruck. Es waren nicht nur die Klöster
und Kirchen, es waren auch die vielen christlichen Kleinode, wie
Bildstöcke, Kapellen, Steinkreuze und Madonnenstatuen, die
Stationen der Besinnung waren. Diese lebendigen Zeugen
christlicher Kultur und Vergangenheit haben sich bis heute trotz
aller religiösen Reformen im Odenwald sichtbar erhalten.
Wer offenen Auges und Herzens den Odenwald durchstreift, wird
vieles finden, das in ihm ein Lebensbild dieses frommen Völkchens
entstehen läßt. So wird er in der Nähe Michelstadts die
Einhardsbasilika finden, das wohl älteste Gotteshaus des
Odenwaldes. Erbaut wurde es um das Jahr 830 von Einhard, Kaiser
Karl des Großen Berater, Biograph und Baumeister.
Oder er wird inmitten des Barockstädtchens Amorbach das ehemalige
Benediktinerkloster, auch Marienmünster genannt, besuchen, dessen
romantische Türme den Reisenden schon von weitem grüßen.
Sehenswert in dieser Abteikirche sind vor allem die weithin
bekannte und größte Orgel der Gebrüder Stumm (1774�82), die
Stuckarbeiten des Johann Michael Feichtmayr und die
klassizistische Klosterbibliothek, die bis heute mit all ihren
Kostbarkeiten erhalten ist.
Folgt man auf religiösen Pfaden den Madonnenstatuen und
Kreuzigungsgruppen von teils beachtlicher bildhauerischer
Qualität, den barocken Bildstöcken, Brückenheiligen und
Wegekapellen durch das „Madonnenländchen“, so erwartet den Pilger
in Walldürn die mächtige Wallfahrtskirche zum „Heiligen Blut“,
neu errichtet in den Jahren 1698 bis 1727. Noch bis ins Jahr 1000
hier der Ort Turninu, im Volksmund „Dürn“ genannt. Zu Walldürn
wurde das Städtchen durch jenes geheimnisvolle Geschehen im Jahre
1330, als einem Priester das Mißgeschick widerfuhr, einen
gefüllten Kelch umzustoßen. Auf dem Korporale, dem Kelchtuch,
erschien dort, wo der geweihte Wein auf dem Linnen seine Spuren
hinterließ, das Bild des Gekreuzigten, von elf dornengekrönten
Häuptern umrankt. Das Bekanntwerden dieses Ereignisses machte den
Gnadenort so berühmt, daß er zur bedeutendsten Pilgerstätte des
Odenwaldes wurde.
Nachdem Papst Eugen IV. das Blutwunder in einer päpstlichen Bulle
(Erlaß) 1445 bestätigte, sollen im 15. Jahrhundert jährlich mehr
als 100.000 Menschen nach Walldürn gepilgert sein. In prunkvoll
feierlichen Prozessionen zogen auch in späteren Jahrhunderten
Pilgermassen aus Köln, Mainz, Würzburg, Fulda und auch aus der
Kurpfalz zu Fuß mit Kreuz und Fahnen quer durch den Odenwald.
Gerade an diesen Wegen befinden sich die schönsten
Sandstein�Wegekreuze und Gelübte�Bildstöcke von meisterhafter
Gestaltung und Ausführung. An des Odenwalds östlicher Grenze, der
Tauber, liegt das Zisterzienser�Kloster Bronnbach. Es zählt noch
heute zu den bedeutendsten Klosteranlagen Süddeutschlands.
Gegründet wurde Bronnbach als sogenanntes Tochterkloster von
Maulbronn. Sehenswert hier in Bronnbach ist vor allem der rundum
erhaltene romanische Kreuzgang, der Josephssaal, mehrere
Barockaltäre und das wertvolle, holzgeschnitzte Chorgestühl. Der
Gesang der Mönche ist aber längst verklungen.
Interessant und im Odenwald sehr selten sind Friedhöfe (etwa
Schlierbach bei Lindenfels), auf denen Gräber mit Totenbrettern
versehen sind. Diese Totenbretter, auf denen früher die Leichen
aufgebahrt waren, wurden, mit dem Namen des Verstorbenen
beschriftet, über dem Grab als Totenmal errichtet. Von diesem
religiösen Brauch ist man heute völlig abgekommen.
In Zeiten der grassierenden Pest, wie während des 30jährigen
Krieges, in denen ganze Dörfer ausstarben, war oft kein Platz
mehr auf den Kirch� und Friedhöfen, so daß die Toten weit
außerhalb der Ortschaften auf sogenannten Pestfriedhöfen
beigesetzt werden mußten. Hier und da sind solche Plätze heute
noch bekannt.
Nicht nur Friedhöfe, auch andere Orte der Stille, wie die
Walpurgiskapelle bei Weschnitz, die Kapelle St. Amorsbrunn bei
Amorbach, die Ruine der Wallfahrtskapelle Lichtenklinger Hof bei
Eitersbach, mitten im Wald gelegen, das St. Martin und
Veitskirchlein bei Mudau oder einfach eine Madonna am Wegesrand
regten auch früher schon zum Nachdenken über Werden und Vergehen
an.
Aus: RNZ, 1995, Herbert Seipel